Guten Tag,
«Ich bin auch kein Freund von Superreichen, die mit Geld um sich werfen»
Bei Annahme der Juso-Initiative müssten seine Kinder Erbschaftssteuern zahlen. Der Chef der Liftfirma Emch sagt, was ihn an der Debatte ärgert.

Firmenchef Bernhard Emch: Seine Kinder müssten nach seinem Tod die Firma verkaufen, aufspalten oder sich stark verschulden, sollte die Volksinitiative für die Erbschaftssteuer angenommen werden.
Thomas MeierWerbung
Er begann mit zwölf Jahren, in der Firma seines Vaters zu arbeiten. Sein Sackgeld verdiente er separat. Einer Partei gehört er nicht an. Der Stadt Bern zahlt er hohe Steuern. Und doch steht Beat Emch zu den Wurzeln des Familienunternehmens in Bern-Bümpliz. Der Chef der Liftbaufirma Emch lobt Tugenden wie Fleiss und Einsatz, die er zunehmend nicht bei Schweizern, sondern bei Ausländern findet. Mit der Juso, die das Volk gegen Reiche aufhetze, geht er hart ins Gericht.
Herr Emch, sind Sie reich?
Nein. Vermögend bin ich, ja.
Wer ist für Sie reich? Bill Gates?
Ich kenne seine Vermögensstruktur nicht. Jemand, der sich mehrere Ferienwohnungen, eine Jacht oder jederzeit einen Jet leisten kann und viel liquides Geld besitzt, ist reich. Im Unterschied zum Vermögenden, dessen Geld gebunden ist.
Wo steckt Ihr Vermögen drin?
Es ist in der Firma gebunden.
Haben Sie eine Jacht?
Nein.
Ein Ferienhaus? Und falls ja, wo?
Am Neuenburgersee. Es gehört meinen Eltern.
Ein Haus oder ein dort übliches Strandhüüsli?
Ein kleines Chalet, das keine Heizung hat und in dem man im Winter das Wasser und den Strom abstellen muss.
Das ist kein Luxus. Was für ein Auto fahren Sie?
Einen BMW im Geschäft und einen Opel für die Familie.
Ganz normal – und dennoch, sagen Sie, wären Ihre Erben von der Erbschaftssteuer-Initiative betroffen, die Vermögen über 50 Millionen Franken besteuern will?
Ja, das in der Firma gebundene Vermögen liegt wohl über diesem Schwellenwert. Ich führe die Firma zusammen mit meinem Bruder. Wir haben 250 Mitarbeitende.
Haben Sie für den Fall der Annahme vorgesorgt?
Nein. Ein Wegzug wäre für uns kein Thema, denn unsere Kernkompetenz ist die Einzelfertigung mit Schweizer Produktion. «Swiss made» hat bei unseren Kunden im Ausland einen weit grösseren Stellenwert, als man es hier wahrnimmt.
Bernhard Emch
Bernhard Emch (51) wuchs in Bern auf und schloss zur Jahrtausendwende an der ETH Zürich sein Studium zum Maschineningenieur ab. 2002 übernahm er mit seinem Bruder Hansjürg in vierter Generation den familieneigenen Betrieb Emch Aufzüge. Ab 2010 führte Bernhard Emch elf Jahre lang den Handels- und Industrieverein der Region Bern, seit 2021 ist er Vizepräsident des kantonalen Handels- und Industrievereins. Emch hat drei Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren.
Werden Ihre Kinder, die fünfte Generation seit der Firmengründung, die Liftbaufirma einst übernehmen?
Der Reiz eines Familienunternehmens ist, es über Generationen weiterführen zu können. Für meine Kinder, die zwischen zehn und vierzehn Jahre alt sind, kommt die Frage zu früh, für die Kinder meines Bruders, die um die zwanzig Jahre alt sind, ebenfalls. Es gibt für sie keinen Zwang, sich einzureihen.

Bernhard Emch, Chef des Familienunternehmens Emch Aufzüge.
Thomas Meier
Bernhard Emch, Chef des Familienunternehmens Emch Aufzüge.
Thomas MeierWerbung
Haben Sie die Höhe der Erbschaftssteuern geschätzt, die Ihre Kinder bei Ihrem Ableben bezahlen müssten?
Das ist eine knifflige Frage, denn mein Bruder und ich sind zwei Hauptaktionäre. Wir haben es so geregelt, dass beim Ableben des einen die Aktien an den anderen übergehen. So bleiben sie im Kreis der aktiven Familienangehörigen. Der Überlebende wäre Alleinaktionär, und der Firmenwert läge über 50 Millionen Franken. Sagen wir, der Firmenwert betrüge dannzumal 80 Millionen Franken. Abzüglich des Freibetrags müssten die Erben dann 30 Millionen versteuern. Davon ginge die Hälfte, 15 Millionen, an den Fiskus. Bei einer so hohen Summe wäre der Fortbestand der Firma gefährdet.
Die in der Firma aktiven Erben müssten einen Kredit beantragen, um die Steuerschuld zu bezahlen.
Kredite von Dritten wären die eine Möglichkeit. Die andere wäre, Teile der Firma zu verkaufen oder an die Börse zu bringen. Mit anderen Worten, die Juso-Erbschaftssteuer würde indirekt dazu führen, dass Familienfirmen aufgeteilt und verkauft würden. Die Variante der Kreditaufnahme hätte zur Folge, dass Geld zum Absorbieren von Krisen und zur Finanzierung neuer Geschäfte fehlen würde, weil Zinsen bedient und Kredite amortisiert werden müssten.
Werbung
Sie sind seit 2002 operativ verantwortlich, zusammen mit Ihrem Bruder Hansjürg. Haben Sie Krisen erlebt?
Ja. Die erste Krise waren die Folgen des Irak-Kriegs, der zu grosser Unsicherheit und Stillstand führte. Viele Bauprojekte wurden damals gestoppt. Das Gleiche galt in der Finanzkrise 2008, in den beiden Wechselkurskrisen 2012 und 2015 und zuletzt während der Pandemie. Jede Krise haben wir dank den Reserven der Firma überlebt, die in guten Jahren aufgebaut wurden. Die Erbschaftssteuer hätte zur Folge, dass sie fehlen würden, weil Steuerschulden abbezahlt werden müssten.
Die Firma Emch Aufzüge und der internationale Liftbau
Die Firma begann 1880, Warenlifte für Mühlen zu bauen. 1914 weihte sie den ersten Personenlift der Schweiz ein. Emch wurde ausgezeichnet, doch nicht wegen dieses Meilensteins, sondern weil sie Kugel- statt Gleitlager verwendete, die den Energieverbrauch massiv senkten. Emch beschäftigt rund 250 Personen und betreibt eine Niederlassung in Frankreich. Sitz und Produktion befinden sich in Bern-Bümpliz.
Der Liftmarkt wird weltweit von fünf Liftherstellern dominiert: Otis, Thyssenkrupp, Kone, Schindler und Mitsubishi. 80 Prozent aller Lifte weltweit befinden sich in Hochhäusern ausserhalb Europas. Weil der Grossteil der Gebäude in Europa bloss zwischen fünf und zwölf Stockwerken hoch ist und die Häuser durchschnittlich älter sind, sind hier (noch) weniger Lifte verbaut. Dennoch ist die Liftdichte in Europa am höchsten, unter anderem weil hier öfter behindertengerecht gebaut wird.
Der Personenlift geht auf den Otis-Firmengründer Elisha Otis zurück. Er erfand 1853 die erste Sicherheitsbremse, die Lifte im Notfall vor dem Absturz schützte. Erst seit diesem Zeitpunkt gibt es Personenlifte.
Haben Sie je krisenbedingt Angestellte entlassen?
Nein, wir haben seit 2002 nie aus wirtschaftlichen Gründen Mitarbeitende entlassen. Diese Probleme stellen sich eher Firmen, die knapp rechnen und externe Investoren haben, die auf eine laufende Rendite drücken. Traditionsreiche Familienunternehmen müssen das nicht, und Emch ist nicht das einzige. Wir sind sozial eingestellt und sorgen für unsere Leute. Das ist möglich, weil wir die Eigentümer sind.
Werbung
Wie lange bleiben Ihnen Ihre Angestellten treu?
Sie bleiben im Durchschnitt 18 Jahre. Die Dienstältesten sind seit 35, 40 Jahren bei uns. Ein Pensionierter, der 40 Jahre bei uns war, arbeitet jetzt in Teilzeit projektbezogen bei uns. Es ist ein Geben und Nehmen.

Bernhard Emch, Chef des Familienunternehmens Emch Aufzüge.
Thomas Meier
Bernhard Emch, Chef des Familienunternehmens Emch Aufzüge.
Thomas MeierWas hat Sie am meisten genervt in der Debatte um die Volksinitiative zur Erbschaftssteuer?
Dass man medial auf die Superreichen fokussiert. Dass man sie porträtiert und gegen sie schiesst. Das ist ein emotionales Thema, aber ein völlig falscher Fokus. Ich bin auch kein Freund von Superreichen, die mit Geld um sich werfen. Der Irrtum ist: Diese Initiative trifft die Superreichen kaum, weil sie und ihre Vermögen mobil sind und sie einfach wegziehen können, im Gegensatz zu hier verwurzelten Unternehmerfamilien. Hier liegt die grosse wirtschaftliche Gefahr.
Haben Sie mit Juso-Leuten einmal darüber diskutiert?
Leider nicht. Das täte ich gern. Zum Beispiel widerspräche ich der Aussage eines Juso-Manns im Fernsehen, dass es einfach wäre, einen Bankkredit zu erhalten, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Er ignoriert, dass, sobald die Firma einen Kreditgeber hat, dieser im Betrieb mitreden will. In schlechten Jahren kann es dann schnell passieren, dass die Bank die Firma zwingt, Arbeitsplätze abzubauen. Einem Fremdkapitalgeber geht es nur ums Geld. Eine jahrhundertealte Firmentradition ist ihm egal.
Werbung
Sie haben eine Tochterfirma in Frankreich, die Montage und Wartung betreibt. Das Land hat hohe Erbschaftssteuern. Wie machen es Unternehmerfamilien dort?
Die dortige Erbschaftssteuer ist nicht so extrem wie die, welche die Juso fordert. Sie ist abgestuft und nimmt auf Betriebe Rücksicht, um deren Fortbestand nicht zu gefährden. Tatsache ist aber, dass es deshalb in Frankreich weit weniger familiengeführte KMU gibt als in der Schweiz.
Ein Vorteil für Sie?
Ja, wir haben in Frankreich keine Konkurrenz im Bereich Speziallifte. Dies ist für uns eine grosse Chance, auch weil in Frankreich Wert auf gute Architektur gelegt wird.
Einige Ökonomen sagen, dass Erben wirtschaftlich suboptimal sei. Es binde Mittel und mache die nachfolgenden Generationen faul. Sehen Sie das auch so?
Ich würde dem nicht widersprechen. Wenn Geld in Luxus angelegt wird und die Kinder der Reichen nicht arbeiten müssen, ist etwas falsch. Bei uns ist das anders. Unser Vater erzog uns ohne jeden Luxus zu Berufstätigen. Wir erziehen unsere Kinder genauso. Unser Vater pflegte zu sagen: Ihr könnt euch zu Weihnachten und zum Geburtstag je etwas wünschen. Alles darüber hinaus müsst ihr euch verdienen. Das einzige Privileg unserer Kinder ist, dass sie jederzeit einen Ferienjob erhalten. Ich ging ab zwölf Jahren jährlich zwei, drei Wochen im väterlichen Betrieb als Aushilfe oder Handlanger arbeiten. Wir bekamen dreckige Finger und wussten, was es heisst, bei eisiger Kälte zu arbeiten. Ich behaupte, dass dies in vielen Unternehmerfamilien genauso gelebt wird. Das Gefährliche an der Initiative ist, dass alle Vermögenden in den gleichen Topf geworfen werden.
Werbung
Milliardär Alfred Gantner sagte, über eine moderate Erbschaftssteuer lasse sich diskutieren. Mit der Vermögenssteuer bezahle er übers ganze Leben betrachtet schon sehr viel Steuern. Haben Sie das durchgerechnet?
Nein. Aber ich kann bestätigen, dass wir, seit ich mit meinem Bruder die Firma übernommen habe, jährlich hohe Vermögenssteuern zahlen, die sich über die Jahre stark summieren. Hinzu kommt die finanzielle Belastung, die wir 13 Jahre lang trugen, um den Erbanteil der Geschwister abzuzahlen. In dieser Zeit lebte meine Familie sehr bescheiden. Ich hatte Studienfreunde, die mich damals foppten: «Bernhard, du spinnst doch. Ich habe einen coolen Managerjob mit einem hohen Lohn, bin flexibel, kann ins Ausland gehen und nach fünf Jahren ein Sabbatical einlegen. Du bist jetzt gebunden.» Das war eine Belastung. Sollte die künftige Generation die Juso-Erbschaftssteuer mitzahlen müssen, käme eine weitere Hürde dazu, wenn sie die Nachfolge übernehmen möchte.
In wie vielen Schweizer Gebäuden steckt ein Emch-Lift?
Über sechstausend Emch-Lifte sind in Betrieb.

Emch Aufzüge sind ein edles Nischenprodukt.
ZVG
Emch Aufzüge sind ein edles Nischenprodukt.
ZVGWerbung
Ihre Marktnische sind eine Art Gucci-Lifte, richtig?
Ja, doch das ist nur ein Teil. Generell machen wir Lifte in Massanfertigung. Es gibt solche mit wertvollem Architekturdesign und Spezialmassen, etwa für historische Gebäude, oder solche mit hohen Anforderungen wie zum Beispiel drehbare Autoaufzüge, versenkbare Warenlifte und Rooftop-Lifte.
Teure Chalets in Gstaad haben solche Speziallifte.
In Gstaad gibt es tatsächlich Speziallifte von uns.
Die Schweiz war kein Liftpionierland. Es wurden Lifte nachgebaut, die im Ausland erfunden wurden.
Der Eindruck stimmt. Die Innovation passierte hierzulande im Kleinen, bezogen auf unsere kleinteilige Wirtschaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg stark entwickelte. Schindler ging zum Beispiel in den Massenmarkt, wir spezialisierten uns. Und wir halten bis heute an der kompletten Produktion in der Schweiz fest und bauen zirkuläre Lifte, abgeleitet vom Wort zirkuläre Wirtschaft. Wir forschen und entwickeln Lifte, die fünfzig oder mehr Jahre halten. Damit sinkt der Ressourcenverschleiss wesentlich.

Bernhard Emch, Chef des Familienunternehmens Emch Aufzüge.
Thomas Meier
Bernhard Emch, Chef des Familienunternehmens Emch Aufzüge.
Thomas MeierWerbung
Sie erreichen im Grunde privat, was die Juso-Initiative fordert: mehr Klimapolitik. Doch die Juso will dafür zweckgebunden Geld aus der Erbschaftssteuer.
Alle, die Kinder haben, beschäftigt die Zukunft. Als Ingenieur bin ich der festen Überzeugung, dass wir der Klimaerwärmung mit Innovation begegnen müssen. Doch die Juso-Initiative bewirkt das Gegenteil, sie schadet der Innovation, weil sie innovativen Firmen Geld entzieht. Die Geschichte zeigt, dass staatliche Klimaprojekte weit weniger effizient sind als solche von Privaten. Die Erbschaftssteuer ist falsch, weil sie Geld von den Unternehmen zum Staat verschieben will.
Ihr Sitz ist in Bern, der Steuerhölle der Schweiz, während etwa Schindler im Tiefsteuerkanton Luzern residiert. Warum tun Sie sich das an?
Hier sind unsere Wurzeln. Auch sind wir eine Produktionsstätte und kein Dienstleistungsbetrieb, den man einfach verlagern kann. Richtig ist, dass wir einen Wettbewerbsnachteil haben, weil Mitbewerber ihren Sitz in steuergünstigeren Kantonen haben. Sollten wir uns hier in Bern nicht weiterentwickeln können, werden wir bei der Suche nach einem neuen Standort das Steuerthema berücksichtigen.
Sind Sie, ausser im Berufsverband, politisch aktiv?
Ich unterscheide gern zwischen Sach- und Parteipolitik. Mir geht es um die Sache, nicht um Ideologie. Als Unternehmer könnte ich nicht sagen, welche Partei mir am nächsten steht. Je nach Thema liegt mir die Haltung der SVP, der FDP oder gar der SP näher. Als Unternehmer ist mir die soziale Verantwortung wichtig. Beispielsweise engagiere ich mich in der Integration von Langzeitarbeitslosen und Behinderten. Als Politiker wäre ich wohl ein Wilder.
Werbung
Sie sind froh über den Entscheid der FDP, das EU-Vertragspaket zu unterstützen?
Ich bin für die Bilateralen III und finde es schade, dass das Thema so emotional diskutiert wird. Ich wünsche mir eine sachliche Debatte. Dem Grossteil der Wirtschaft sind diese Verträge wichtig. Folgerichtig hat die FDP dafür votiert.
Wie wichtig sind für Emch die bilateralen Verträge?
Sehr wichtig. Sie haben uns sehr geholfen, den europäischen Markt für Speziallifte zu erschliessen. Der Export wurde stark vereinfacht. Auch können wir seit dem Inkrafttreten der Verträge unsere Leute einfacher als davor zur Montage ins Ausland schicken. Der Abbau von Handelshemmnissen und die Übernahme europäischer Normen durch die Schweiz waren ein wesentlicher Schritt zum Erfolg. Heute gelten dieselben Normen, was unsere Produktion stark vereinfacht. Diese Übernahme von EU-Marktrecht ist kein Nachteil für die Schweiz, wie oft behauptet wird. Selbst asiatische Hersteller bezeichnen unsere Normen als High Standard und sind neidisch auf den harmonisierten Markt, den es in Asien nicht gibt.
Die Gegnerschaft aber warnt vor mehr EU-Bürokratie.
Die harmonisierten Regeln in unserer Branche haben zum Bürokratieabbau geführt. Sie sind ein Segen. Ich glaube, das Gleiche gilt für viele Vorschriften, die mit den Bilateralen I und II eingeführt wurden. Im Vorfeld warnte man auch davor, doch heute muss man sagen, dass sich die Harmonisierung ausgezahlt hat.
Werbung
Die Gegnerschaft sagt, das Freihandelsabkommen von 1972 sei für den freien Warenverkehr mit Europa viel wichtiger als die Bilateralen I und II.
Das mag sein, aber schauen Sie sich die von der EU angekündigten Stahlzölle an. Die Schweiz wird als Drittstaat behandelt. Wenn wir einen Lift ausführen, müssen wir kontrollieren, ob wir noch auf der Ausnahmeliste der EU-Stahlzölle sind. Ein gutes Einvernehmen der Schweiz mit der EU ist für die Wirtschaft von grosser Bedeutung.
Zugabe
Ihre Vorstellung von Glück?
Dass ich gesund bleibe für die Familie und den Betrieb.
Ihre grösste Angst?
Die unsichere geopolitische Lage und dass meine Kinder auf die schiefe Bahn geraten.
Die Eigenschaft, die Sie an sich selbst am meisten bedauern?
Das zu grosse Bedürfnis nach Harmonie.
Ihre grösste Extravaganz?
Genauigkeit und Korrektheit. Es heisst, ich sei pingelig und
ein Perfektionist.
Die am meisten überschätzte Tugend?
Bescheidenheit. Viel zu viele Menschen glauben, sie seien bescheiden, leben aber nicht so.
Bei welcher Gelegenheit sagen Sie eine kleine Unwahrheit?
Wenn mein jüngster Sohn fragt, ob es den Samichlaus wirklich gibt.
Welche Phrasen verwenden Sie am häufigsten?
Unseren Firmenleitsatz: «Engagiert, mutig, clever und hilfsbereit». Die Anfangsbuchstaben dieser Wörter führen zu unserem Firmennamen.
Das Talent, das Sie am liebsten hätten?
Böser zu sein als heute.
Die grösste Errungenschaft der Schweiz?
Das Zusammenspiel dreier Tugenden: der Eigenverantwortung der Bürger mit der Kompromisskultur und dem dualen Bildungssystem, das jedem eine Chance gibt.
Wie wichtig ist für Sie der freie Personenverkehr?
Sehr wichtig. Dank ihm können wir unsere Spezialisten im In- und Ausland ohne jede Bürokratie einsetzen.
Einige Ihrer Mitarbeiter stammen aus Balkanstaaten, die nicht in der EU sind. Warum setzen Sie auf sie?
Unsere Firma hat immer wieder von der Migration in die Schweiz profitiert. Früher waren es Italiener und Spanier. Dann war der Krieg in Ex-Jugoslawien, und viele Secondos aus dieser Migrationswelle haben sich als arbeitstüchtige Leute erwiesen, besonders in der Montage und Wartung. Das ist ein Bereich, in dem sich Herr und Frau Schweizer die Finger nicht mehr dreckig machen wollen. Sie arbeiten auch ungern im Pikettdienst. Von solchen Leuten haben wir zu wenige. Wir suchen sie schon lange mit Inseraten im EU-Raum – vergeblich. So kamen wir auf die Idee, Angehörige unserer Secondo-Mitarbeiter aus Ex-Jugoslawien zu rekrutieren. Doch das ist ein Krampf, weil sie in Drittstaaten wohnen. Sie unterliegen Kontingenten, und die Hürden für eine Bewilligung sind sehr hoch, die hiesige Bürokratie macht es uns schwer. Bisher habe ich so nur drei Mitarbeiter einstellen können.
Werbung
Was ist Ihre Alternative?
Die Alternative ist, dass wir anderen Schweizer Firmen und Branchen die Leute abwerben. Sie fehlen dann in der Landwirtschaft, bei den Automechanikern, in Elektrofirmen – die dann ihrerseits Personal aus dem Ausland holen müssen. Mit diesem Dominoeffekt habe ich grosse Mühe. Umgekehrt verstehe ich aber auch die Angst vor der Zehn-Millionen-Schweiz. Sie muss ernst genommen werden.
Wird Ausländerfeindlichkeit zunehmend geschürt?
Ich unterscheide zwischen Zugewanderten und Flüchtlingen, die wir brauchen oder denen wir Schutz bieten und die unsere Werte übernehmen wollen, und jenen, die für Probleme sorgen. Ich habe solche Gewalt von nicht integrierten Ausländern selber beobachtet, etwa in den Gangs. Ausländer, die sich nicht anpassen wollen, haben in unserem Land eigentlich nichts zu suchen.
Externe Inhalte
An dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.
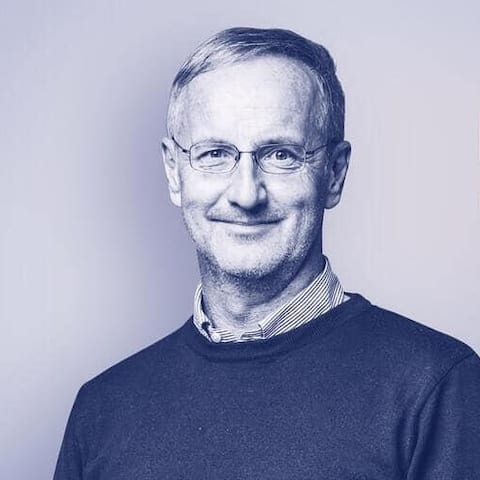
Andreas Valda
Werbung
