Guten Tag,
Darum bleibt Wohneigentum für die meisten in der Schweiz ein Traum
Das Eigenheim ist unerschwinglich geworden. Erschwert haben es die Bankenaufsicht, die Raumplanung und das Volk. Auswege aus der Wohnbaukrise.

Wohneigentum ist unerreichbar geworden. Was die Gründe sind und wie man den Trend umkehren könnte.
Tessy Ruppert / Midjourney (Diese Illustration wurde von einem KI-Modell generiert und von einem Menschen überprüft und finalisiert.)War er ein Prophet? Jean-François Rime, der frühere Präsident des Gewerbeverbandes und Unternehmer, sagte im Jahr 2013: Falls das Volk eine neue, restriktive Raumplanung annehme, sei «die notwendige Wohnfläche für die wachsende Bevölkerung nicht mehr gewährleistet». Der Wohnungsmangel werde «noch gravierender werden als bisher». Die Geschädigten wären Familien und der Mittelstand.

Hans-Ulrich Bigler (l.), Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, und Jean-Francois Rime, Präsident, kämpften 2013 gegen die Vorlage für verdichtetes Bauen (Raumplanungsrevision).
Keystone
Hans-Ulrich Bigler (l.), Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, und Jean-Francois Rime, Präsident, kämpften 2013 gegen die Vorlage für verdichtetes Bauen (Raumplanungsrevision).
KeystoneDie Vorlage propagierte eine starke Reduktion von eingezontem Bauland und die Verdichtung der Städte nach innen. Das Volk stimmte ihr 2013 mit 54 Prozent Ja-Stimmenanteil zu. Ein schicksalhafter Entscheid, wie sich heute herausstellt. Denn die urbane Schweiz klagt über sehr knappen Wohnraum. Noch schwieriger ist der Zugang zu Wohneigentum geworden. Vor der Abstimmung 2013 konnten sich rund 18 Prozent aller Haushalte ein Haus oder eine Wohnung leisten. Heute sind es noch 7 Prozent.
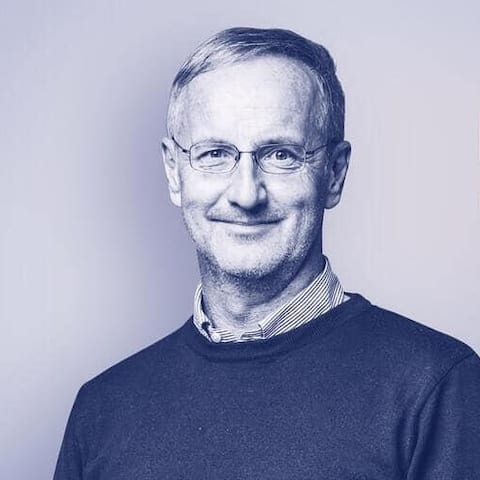
Werbung
