Guten Tag,
Die Schweiz blockiert sich selbst
Wegen den US-Strafzöllen wird der Ruf nach Reformen lauter. Doch Bundesrat, Parlament, Parteien und das Stimmvolk blockieren sich gegenseitig.

Eine Blockade nach der anderen: In der Schweiz kommen Reformen nicht voran. (Diese Illustration wurde von einem KI-Modell generiert und von einem Menschen überprüft und finalisiert.)
Tessy Ruppert / MidjourneyFür die Tech-Industrie ist es fünf vor zwölf. «Die Reserven sind aufgebraucht», sagt Stefan Brupbacher, der Direktor des Verbands Swissmem, in einem kürzlich publizierten Video. Der Druck sei mittlerweile so hoch, dass «mehrere zehntausend» weitere Arbeitsplätze in Gefahr stünden. Umso wichtiger sei es, dass jetzt Bundesrat, Parlament und Bevölkerung einsähen, dass die Maschinenbau-, Elektronik- und Metallbaubrauche (MEM) Unterstützung brauche.
Die Branche verlange auch keine Subventionen, sondern den «radikalen Abbau» von Bürokratie, weniger Lohnnebenkosten, Steuersenkungen, weniger Handelshemmnisse, weniger Umweltabgaben, erleichterte Kriegsmaterialexporte und mehr Freihandel. Brupbacher warnt: «Jeder, der gegen Freihandelsabkommen ein Referendum ergreift, schiesst in den Rücken der Mitarbeitenden der Tech-Industrie.»

Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher fordert eine radikale Reform zur Rettung der Exportwirtschaft.
Marcel Bieri
Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher fordert eine radikale Reform zur Rettung der Exportwirtschaft.
Marcel Bieri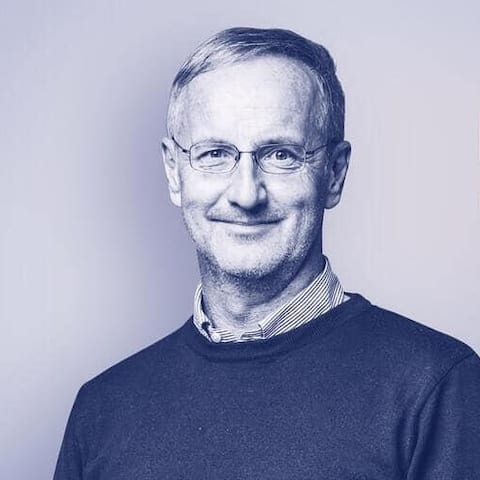
Werbung

