Guten Tag,
Mitten in der Schweiz boomt die deutsche Waffenschmiede
Flughäfen werden mit Drohnen lahmgelegt. Die weltbeste Drohnenabwehr wird in Zürich-Oerlikon entwickelt. Doch die Zukunft des Werks ist offen.

Das Werk der Rheinmetall in Zürich-Oerlikon ist unscheinbar. Die dort entwickelte Drohnenabwehr ist aber begehrt in ganz Europa.
KEYSTONE/DPA/SEBASTIAN GOLLNOWNördlich des Bahnhofs Zürich Oerlikon boomt die Wirtschaft. Aus dem früheren Industrieareal entstand ein Dienstleistungs- und Eventquartier. Ein Coop, ein Jumbo, zwei Eventhallen und ein Park zieren das Strassenbild Neu-Oerlikons. Edle Glasfassaden sind das Wahrzeichen, der Weltsitz der ABB und die Landeszentrale von PWC befinden sich hier.
Doch was man beim Rundgang durchs Quartier überhaupt nicht denken würde: Hier wird auch Weltklasserüstung entwickelt und hergestellt – das Abwehrsystem Skyranger, das Drohnen auf kurze Distanz zerstören kann. Die Frage ist: Wie lange darf Skyranger in Oerlikon noch wachsen? Das Schweizer Exportregime für Rüstung ist sehr restriktiv.
Das Logo des Herstellers ist diskret angebracht: Rheinmetall. Der deutsche Rüstungskonzern erwarb 1999 die frühere Waffenschmiede Oerlikon-Bührle, die kurzzeitig Oerlikon Contraves hiess. Das Geschäft dümpelte so vor sich hin, weil Frieden war und Armeen runtergespart wurden. Dann brach der Krieg in der Ukraine aus. Rheinmetall-Chef Armin Papperger bot der Ukraine als erster Industrieller an, zu helfen, nachdem Russland das Land überfallen hatte.
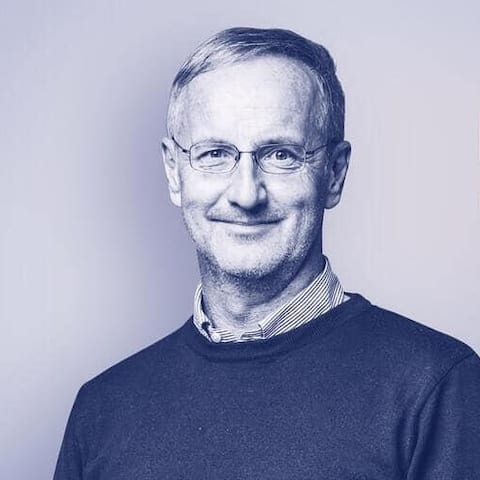
Werbung

