Guten Tag,
Was Führungskräfte von Sportcoaches lernen können
Wolfgang Jenewein ist Coach von Sportlern wie Skifahrer Aleksander Kilde. Seine Tipps funktionieren auch im Businessalltag.
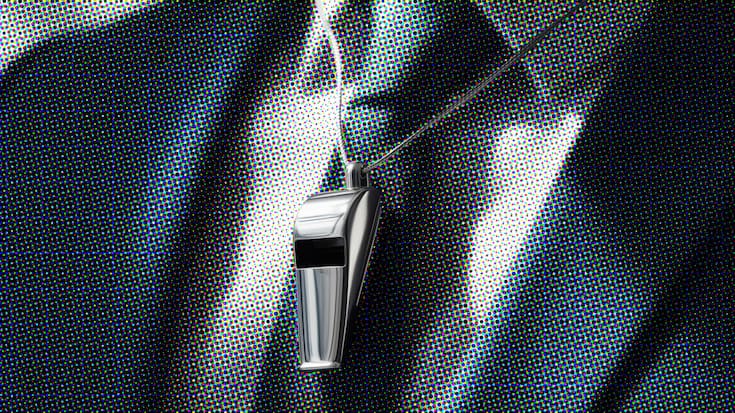
Vom Spielfeld ins Büro: Führungskräfte können von Sportcoaches viel für ihr Arbeitsteam lernen.
Tessy Ruppert / Midjourney (Diese Illustration wurde von einem KI-Modell generiert und von einem Menschen überprüft und finalisiert.)Der Sieg ist zum Greifen nah. Doch dann geht alles schief. Das Segelboot kentert mitten im Atlantik. Der Autopilot fällt aus, das eiskalte Wasser strömt ins Boot, die Segel sind zerfetzt.
Diesen Albtraum erlebte der Schweizer Profisegler Oliver Heer bei einem Rennen zur Qualifikation für die Vendée Globe. Fünf Stunden kämpfte er mit seinem Boot, bis es wieder aufrecht war. Die Unglücksstelle lag nur wenige Kilometer entfernt vom Wrack der Titanic. Als das Adrenalin nachliess, kam die Todesangst.
Wer sich mitten in einem Segelrennen befindet, darf nicht mit seinen Trainern sprechen. Heer brach die Regel und rief seinen Coach Wolfgang Jenewein an. Die Verbindung war schlecht, es blieb keine Zeit für intensives Coaching.

Werbung

