Guten Tag,
Die Kunst des richtigen Framings
Verluste wirken viel stärker als Gewinne: Diese Erkenntnis der Prospect Theory sollten auch Führungskräfte beherzigen.
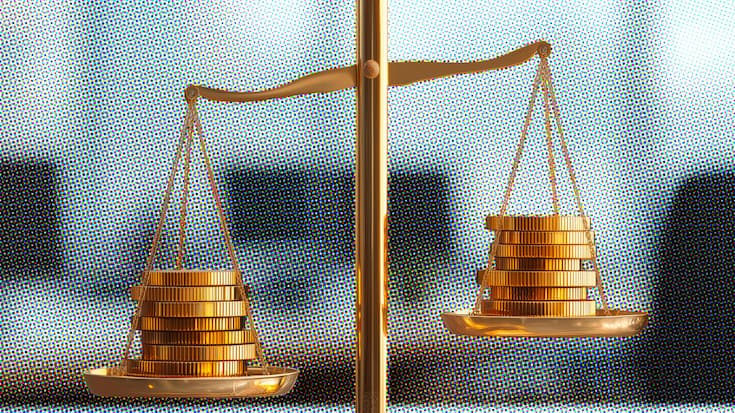
Was gilt als Verlust, was als Gewinn? Es kommt immer auf den Referenzpunkt an. (Diese Illustration wurde von einem KI-Modell generiert und von einem Menschen überprüft und finalisiert.)
Tessy Ruppert / MidjourneyAls der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften im Jahr 2002 dem Psychologen Daniel Kahneman verliehen wurde, war das eine Sensation. Kahnemann wurde für eine Erkenntnis ausgezeichnet, die eine Grundannahme der klassischen Ökonomie infrage stellt: Diese geht davon aus, dass Menschen danach streben, einen Zustand zu erreichen, der ihren absoluten Nutzen maximiert – etwa beim Einkommen, bei ihrem Vermögen, ihrem Gesundheitszustand oder ganz allgemein bei ihren Lebensumständen.
Der 2024 verstorbene Kahneman zeigte gemeinsam mit Amos Tversky auf, dass nicht der Endzustand selbst entscheidend ist, sondern die Tatsache, wie dieser Zustand relativ zu einem Referenzpunkt wahrgenommen wird. Da Tversky bereits 1996 verstorben war und Nobelpreise nicht post mortem vergeben werden, erhielt nur Kahneman die Auszeichnung. Die gemeinsamen Einsichten gingen als «Prospect Theory» in die Wissenschaft ein – und bieten gerade Führungskräften oder Unternehmern wertvolle Unterstützung, um Entscheidungen von Mitarbeitenden, von anderen Stakeholdern und nicht zuletzt die eigenen Entscheide besser zu verstehen.
Einfaches Beispiel: das Lohnangebot für eine Jobkandidatin. Nicht die absolute Höhe des Lohnangebots ist entscheidend dafür, ob sie sich damit zufriedengibt, sondern der Vergleich mit dem Lohn, den sie im Job zuvor erhielt. Der alte Lohn ist der Referenzpunkt. Ein höherer Lohn ist dann ein Gewinn, ein tieferer Lohn ein Verlust. Und die Prospect Theory geht in einem entscheidenden Punkt noch weiter: Gewinne und Verluste im Verhältnis zu einem Referenzpunkt werden in ihrem Ausmass stark unterschiedlich wahrgenommen. Bleiben wir bei den Löhnen als Beispiel: Ein um 1000 Franken tieferer Lohn, als ihn die Jobkandidatin im Job zuvor erhalten hat, wirkt sich sehr viel stärker negativ auf ihr Befinden aus, als sich ein um 1000 Franken höherer Lohn positiv auswirkt.

Werbung

