Guten Tag,
Das Investitions-Paradoxon
Je schneller sich Technologien entwickeln und neue Möglichkeiten eröffnen, desto weniger lohnen sich Investitionen.

Adriel Jost

«Je schneller sich Technologien entwickeln, desto kürzer ist deren Nutzungsdauer – und desto geringer fällt der potenzielle Ertrag der Investitionen aus,» sagt Adriel Jost.
ZVGWerbung
Der technologische Fortschritt weist ein atemberaubendes Tempo auf. In den letzten Jahrzehnten hat sich diese Entwicklung exponentiell beschleunigt. Der Übergang von der analogen zur digitalen Welt – geprägt durch die Verbreitung von PCs, Internet und Mobiltelefonen – erstreckte sich über rund 30 Jahre, von 1970 bis 2000. In den darauffolgenden 15 Jahren revolutionierten Breitbandanschlüsse, Smartphones, Cloud-Computing und soziale Medien unseren Alltag. Seit etwa 2015 erleben wir erneut eine Umwälzung, diesmal durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz und der autonomen Robotik, in nochmals halbierter Zeit.
Eine weitere Beschleunigung des Wandels ist absehbar. Eine Kombination von Quantencomputern und ausgereifter künstlicher Intelligenz könnte Produkte und Dienstleistungen nahezu in Echtzeit vom Konzept zur Marktreife bringen. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen treten damit in immer kürzeren Abständen auf. Diese exponentielle Entwicklung ist für den menschlichen Verstand nur schwer zu erfassen – bringt aber, etwa im medizinischen Bereich, enorme Vorteile mit sich.
Adriel Jost ist Ex-SNB-Mitarbeiter, Fellow am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) in Luzern und Präsident des Thinktanks Liberethica.
Doch wie gehen Unternehmen damit um, dass Innovationen in immer kürzeren Zyklen auftreten? Das hyperdynamische Umfeld eröffnet unzählige neue Geschäftsmöglichkeiten. Das Beispiel OpenAI zeigt, wie sich Start-ups innerhalb kürzester Zeit zu milliardenschweren Unternehmen entwickeln können. Etablierte Unternehmen geraten wiederum unter Druck, technologisch Schritt zu halten. Erhebliche Investitionen sind nur schon erforderlich, um angesichts des technologischen Wandels nicht zurückzufallen.
Während neue Technologien hohe Erwartungen wecken, sinkt zugleich der Investitionsanreiz.
Aber lohnen sich diese Investitionen überhaupt? Neue Technologien verdrängen ihre Vorgänger rasch. Auf Investitionen in Maschinen oder IT-Systemen drohen Verluste, wenn deren Nutzen rasch abnimmt. Während also neue Technologien hohe Erwartungen wecken, sinkt gleichzeitig der Investitionsanreiz. Unternehmen sehen sich mit einem Paradoxon konfrontiert: Je schneller sich Technologien entwickeln und neue Möglichkeiten eröffnen, desto kürzer ist deren Nutzungsdauer – und desto geringer fällt der potenzielle Ertrag der Investitionen aus.
Als «Innovator’s Dilemma» wurde das Phänomen bekannt, dass Unternehmen zögern, neue Technologien zu übernehmen, da dies ihre bestehende Infrastruktur entwertet. Nehmen Unternehmen auf diese Infrastruktur Rücksicht, verpassen sie den Anschluss und scheiden aus dem Markt aus.
Werbung
Das heutige Investitions-Paradoxon könnte tiefer greifende Konsequenzen haben. Es betrifft nicht mehr nur einzelne Unternehmen, sondern ganze Märkte. So rechtfertigen sich die aktuell hohen Aktienkurse nur, wenn sich die massiven Investitionen in neue Technologien wie die künstliche Intelligenz tatsächlich in steigenden Gewinnen niederschlagen.
Doch was passiert, wenn diese Technologien von der nächsten bereits abgelöst werden, bevor sie sich auszahlen? Abschreibungen und Verluste werden an der Tagesordnung sein. Die Angst vor sogenannten Stranded Assets – also Vermögenswerten, die kaum Rendite abwerfen, weil sich das technologische und wirtschaftliche Umfeld bereits wieder geändert hat – wird weiter wachsen.
Die Unsicherheit über zukünftige technologische Standards könnte Investitionsentscheidungen hemmen. Technologischer Fortschritt führt also nicht zwangsläufig zu mehr Investitionen. Unsicherheit und kurze Innovationszyklen könnten im Gegenteil dazu führen, dass Unternehmen – insbesondere diejenigen, die nicht zu den allergrössten gehören – zurückhaltender investieren.
Dieser Artikel erschien in der BILANZ 08/2025.
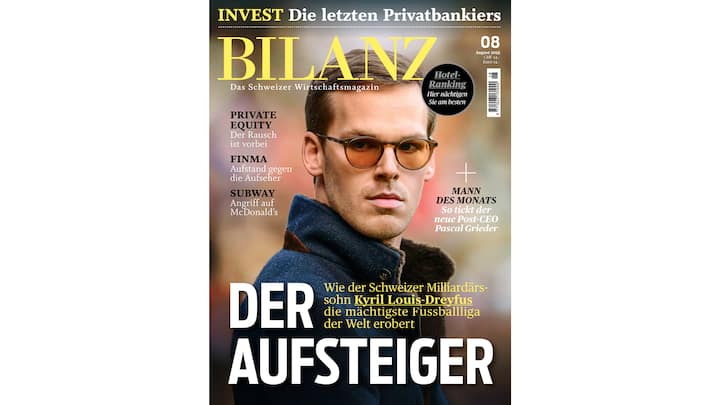
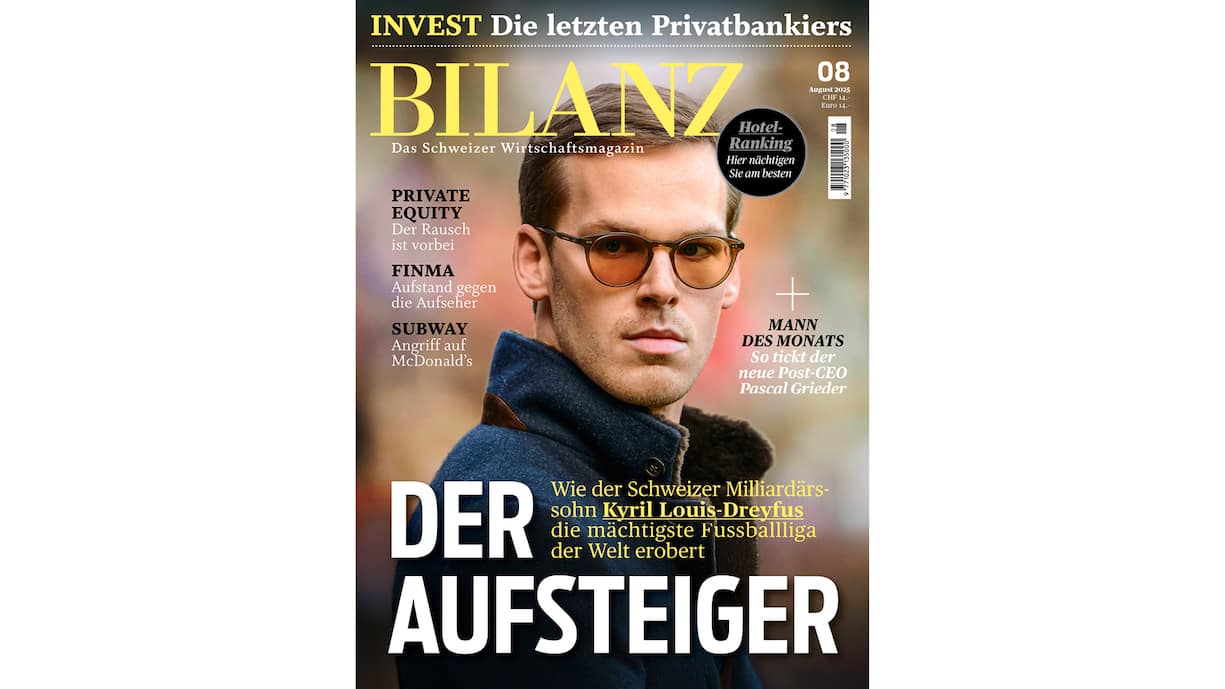
Werbung
Werbung