Guten Tag,
Wie steht es um den Schutz der digitalen Integrität?
Onlinebestellungen, e-ID und mehr: Digitalisierung erleichtert im Alltag zwar vieles, doch die digitale Unversehrtheit bleibt ein Dauerthema.
Monica Fahmy,
Ruth Brüderlin

Gehackt: Kriminelle erbeuteten Daten von 250 Menschen auf Patientendossier.ch.
KeystoneEs ist der Anfang einer Odyssee: Ein 77-jähriger Rentner aus dem Kanton Bern erhält im Januar 2020 eine Rechnung über 230 Franken. Die angebliche Bestellung bei der Import Parfumerie hatte er nie getätigt, überhaupt: Der Mann hatte noch nie etwas online bestellt. Er teilt dies schriftlich mit, erhält dennoch weitere Rechnungen und Mahnungen – und schliesslich die Betreibung. Verzweifelt wendet sich der Mann an das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Erst jetzt überprüfen die beteiligten Firmen die Bestellung ernsthaft. Nur schon, dass die Endung der E-Mail-Adresse des Berners auf «.ru» lautete – «.ru» für Russland –, hätte die Firmen stutzig machen müssen. Erst nach über einem Jahr steht schliesslich fest: Der Rentner ist Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden. Gegen die Täter vorzugehen, ist in solchen Fällen jedoch meist aussichtslos.
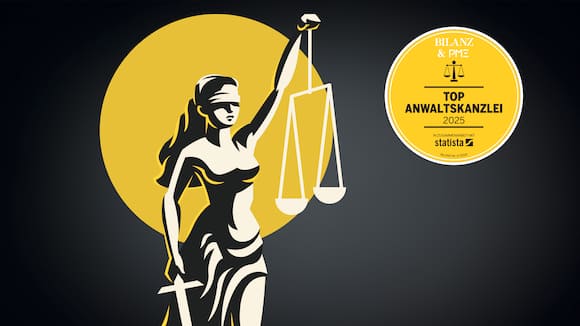
Das sind die Top-Anwälte der Schweiz 2025
Wer sind die besten ihres Fachs? Sehen Sie hier die Liste der Top-Anwälte, erstellt aus über 28'000 Empfehlungen.
Ebenso wenig konnten die Hacker zur Verantwortung gezogen werden, die am 19. September 2022 die Webseite Patientendossier.ch angriffen. Auf dieser Domaine informiert die Koordinationsstelle eHealth Suisse über das elektronische Patientendossier. Rund 250 Namen und E-Mail-Adressen von Personen, die Bestellungen aufgegeben oder Kontaktformulare ausgefüllt hatten, fielen den Hackern in die Hände. Gesundheitsinformationen oder sensible Kundendaten seien zu keinem Zeitpunkt vom Angriff betroffen gewesen, versichert das BAG. Es hätte aber auch anders ausgehen können. Bei einem Cyberangriff auf die US-Plattform «Change Healthcare» im Februar 2024 flossen laut Versicherungskonzern UnitedHealth Group persönliche Angaben und Gesundheitsdaten von einem bedeutenden Teil der US-Bevölkerung ab.
Werbung