Guten Tag,
Swissness bitte! Warum Chefs ohne Schweiz-Bezug nicht mehr gefragt sind
Söldnertum ist out, Gelöbnis zur Heimat in: Firmenlenker müssen sich zur Schweiz bekennen. Kehrt der Filz zurück?
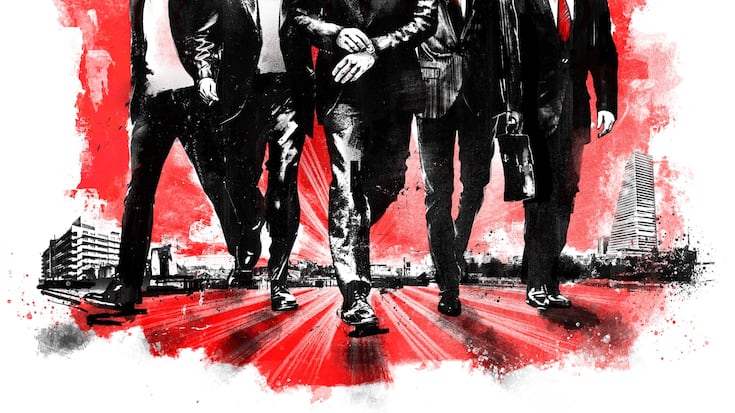
Wer Thomas Gottstein früher als pressescheu beschrieben hätte, wäre als Diplomat durchgegangen. Vor 15 Jahren erstürmte der heutige CS-Chef den ersten Platz im BILANZ-Golf-Ranking. Doch ein Foto war von ihm nicht zu bekommen, geschweige denn ein Interview, genauso wenig wie in all den Folgejahren. Da war der Mann, der mehrere Jahre in der Londoner City heissen Deals nachspürte, ganz Investmentbanker alter Schule: Medien? Teufelszeug.
Heute ist Gottstein flächendeckend präsent. Über seinen Einsatz in der Corona-Krise parlierte er zuerst in der volksnahen «Schweizer Illustrierten» und gab sich als normaler Vater, der seinen jüngeren Sohn beim Homeschooling unterstützt («Der ist zwölf, da kann ich bei Mathematik und Deutsch noch helfen»). Anfang Juli nahm er als erster Bankchef am «Donnschtig-Jass» des Schweizer Fernsehens teil und liess sich sogar zu eine Runde Minigolf herab, in der Golfszene kaum reputationsfördernd. «Man kann nicht erfolgreich sein im Geschäftsleben, wenn man nicht auch Teamplayer ist», antwortete er auf die warmen Fragen des Moderators Rainer-Maria Salzgeber, der den «Thomas» gleich duzte («Wir kennen uns schon lange»).
Und Mitte August lehnte der 55-Jährige via «Weltwoche» zwar die SVP-Begrenzungsinitiative ab («Geht mir zu weit»), outete sich aber als Befürworter der Masseneinwanderungsinitiative von 2014. Das war in der Konzernszene bislang ein Tabu, und für die CS, traditionell die Bank des Zürcher Freisinns, eine unerwartete Wende – Urs Rohner, der grosse Präsidenten-Taktiker an der Spitze, würde sich wohl eher eine Hand abbeissen, bevor er sich öffentlich so pointiert äusserte. Doch Gottstein schert das nicht. Als Spross einer wohlhabenden Unternehmerfamilie – sein Vater war Inhaber der Maschinenfabrik Meteor – ist er am linken Zürichseeufer eigentlich in weltoffenem Geist aufgewachsen. Doch jetzt gilt: Ich bin nah beim Volk.
Und Mitte August lehnte der 55-Jährige via «Weltwoche» zwar die SVP-Begrenzungsinitiative ab («Geht mir zu weit»), outete sich aber als Befürworter der Masseneinwanderungsinitiative von 2014. Das war in der Konzernszene bislang ein Tabu, und für die CS, traditionell die Bank des Zürcher Freisinns, eine unerwartete Wende – Urs Rohner, der grosse Präsidenten-Taktiker an der Spitze, würde sich wohl eher eine Hand abbeissen, bevor er sich öffentlich so pointiert äusserte. Doch Gottstein schert das nicht. Als Spross einer wohlhabenden Unternehmerfamilie – sein Vater war Inhaber der Maschinenfabrik Meteor – ist er am linken Zürichseeufer eigentlich in weltoffenem Geist aufgewachsen. Doch jetzt gilt: Ich bin nah beim Volk.
Über die Autoren
Werbung

